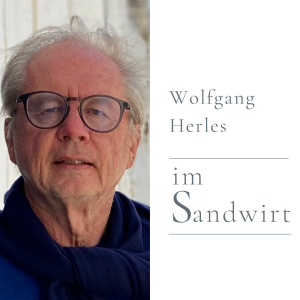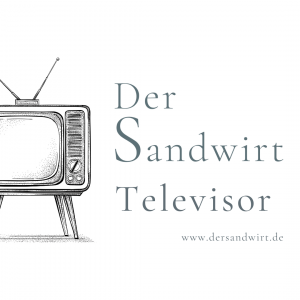Protokolle der Aufklärung #15
Über die Bedeutung des Wortes „Freiheit“ sind voneinander abweichende Auffassungen im Umlauf. „Es gibt kein Wort, dem man mehr unterschiedliche Bedeutungen gegeben hätte als dem Wort Freiheit“, stellt schon Charles-Louis de Montesquieu fest. Ernst Cassirer spricht von der Freiheit als einem „der dunkelsten und vieldeutigsten Begriffe.“ Detmar Doering bemerkt, dass die Gefährdung der Freiheit durch „begriffliche Beliebigkeit“ bedroht sei.
Allen zitierten Autoren ist zuzustimmen.
Die zwei Aspekte der Freiheit
Freiheit wird gewöhnlich nicht so verstanden, als sei damit ein unbändiges Drauflosleben gemeint. Motto: „Der Eigenspontaneität freie Bahn!“
Vielen bedeutet es aber: frei sein „von eines anderen nötigender Willkür“, wie es Immanuel Kant ausdrückt. Der Begriff „Freiheit“ wird also zunächst nicht positiv verstanden (nämlich als Spontanautonomie; siehe meinen Sandwirt-Beitrag „Die Freiheit des Ich“), sondern als Freiheit von …, als Freisein von Zwang, von Manipulation, von der Obrigkeit, von Belästigungen usw., kurz: Freiheit von jeder unberechtigten Behinderung der Eigenaktivität durch andere Menschen. Kant nennt diesen Freiheitsbegriff „negativ“ – im Unterschied zum „positiven“. Beim negativen Freiheitsbegriff steht ein Nicht (das Nichtunterdrücktsein) im Fokus.
So erscheint Freiheit zum einen als Nichtbehinderung der Eigenspontaneität („negative Freiheit“), zum anderen als Autonomie der Eigenspontaneität („positive Freiheit”). Viele angloamerikanische Liberale verbinden mit dem Begriff „positive Freiheit“ einen anderen Sinn. Sie meinen den Umfang eines individuellen Handlungspotentials, so etwas wie „Freiheit zu …“. Aus der Verwechslung des Freiheitsbegriffs mit diesem Potential leiten sie bestimmte soziale Forderungen ab.
Aufgrund unseres realen Erlebens begegnet uns Freiheit zunächst „negativ“. Wenn wir über Freiheit sprechen, assoziieren wir den Zustand, in unseren Spontaneitäten durch andere Menschen nicht behindert zu sein, also das Frei-sein von Unterdrückung und Manipulation. Für Viele ist Freiheit auch nur in dieser Form intellektuell zu erfassen.
An die „negative“ Freiheit denken wir, wenn wir Rainer Maria Rilkes berühmtes Gedicht „Der Panther“ lesen. Dort ist die Behinderungen der Eigenspontaneität in einem eindrücklichen Bild festgehalten. In das Bild projizieren wir gern unser eigenes Leiden an Unfreiheit.
Der innere Schmerz, den wir empfinden, wenn wir der Freiheit beraubt sind, ist übrigens auch der Anlass, sich überhaupt einmal Gedanken über die Freiheit zu machen.
Phänomene jenseits der „negativen“ Freiheit
Der Freiheitslehrer Gerald MacCallum findet für die „negative“ Freiheit die Kurzformel x ist frei von y für z. Mit dieser Formel gelingt es aber nicht, alle Situationen innerhalb der menschlichen Praxis, die mit Freiheit zu tun haben, umfänglich aufzuklären. Es gibt darin Phänomene, die auf Freiheit in noch einem anderen Sinne verweisen und die mit dem nur negativ definierten Freiheitsbegriff nicht zu erfassen sind.
Bei der Beurteilung einer Tat, z. B. durch einen Richter, kommt Freiheit in einem Sinne ins Spiel, der von der MacCallum-Formel erheblich abweicht. Stützte sich der Richter auf diese Formel, müsste er zum Verbrecher sagen: eigentlich dürfte ich dir gar nicht an den Kragen, jedenfalls nicht, wenn ich ein freiheitsliebender Mensch bin. Denn du als Individuum x hast nichts anderes getan, als dich des Freiheitshindernisses y entledigt (der Schaufensterscheibe des Juweliers), um an z heranzukommen (an die dort lagernden Schätze). – Dass ein Richter so etwas niemals sagt, wissen wir.
Um Freiheit über den nur negativen Sinn hinaus zu begreifen, müssen wir genau beobachten, was ein Richter bei der Verurteilung eines Verbrechers tut: Er weist ihm Schuld an der Tat zu. Das kann er nur, wenn er die Ursache der Tat im Täter verortet und wenn er unterstellt, dass der Täter die Möglichkeit hatte, seinen Einbruch zu unterlassen.
Offensichtlich geht es bei Gericht nicht um Ursächlichkeit im Sinne von Naturkausalität, die notwendig eine bestimmte Wirkung hervorbringt. Der Richter setzt voraus, dass der Täter auch anders hätte handeln können. Er setzt voraus, dass er nicht durch etwas außer ihm Befindliches zur Tat veranlasst worden sei. Er unterstellt einen Kausalzusammenhang zwischen Täter und Tat – aber nicht im Sinne von Naturkausalität, sondern im Sinne einer Kausalität, die den Aspekt „Es-hätte-nicht-sein-müssen“ in sich trägt.
Die Kausalität, die wir in die Natur hineinsehen, ist stets eine rücklaufende Kette ohne Ende („regressus ad infinitum“). Die Kausalität, die bei Gericht zum Tragen kommt, hat einen ersten Anfang, und zwar im Täter.
Selbst Kinder haben ein waches Gefühl dafür, dass sie gegenüber einem durch sie Geschädigten „schuldig“ werden können. Sie sind durchaus in der Lage, sich selbst als Quell für bestimmte Handlungsabläufe zu sehen, obgleich ihnen dieser Zusammenhang nicht voll bewusst ist. Das führt im Schadensfall – Fußball in der Fensterscheibe – oft zu heftigem und lautstarkem Abstreiten, wenn von einer Kindergruppe Aufklärung über die Tat verlangt wird.
Halbwegs wache Kinder wissen natürlich längst, wie bei einem Ballspiel die kausalen Zusammenhänge sind (im Sinne von Naturkausalität). Darüber streiten sie auch nicht. Bei ihrem Streit geht es um etwas ganz anderes, nämlich: Wer „ist schuld“ an dem Unheil? Der Paul, von dessen Fuß der Ball ins Fenster gelangte; der Fritz, der vorschlug, hier auf dem Platz könne man spielen, oder die Tina, die behauptete, in dieser Gegend seien alle Fenster aus Panzerglas? Die wildesten Schuldzuweisungen machen die Runde. Jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen.
Auch dieses Phänomen ist vor dem Hintergrund des gewöhnlich ins Feld geführten Kausalbegriffs (im Sinne von Naturkausalität) nicht zu erklären. Das kindliche Schulderlebnis ist das Erlebnis einer Ursächlichkeit, die offenbar ebenfalls den Aspekt „Es-hätte-nicht-sein-müssen“ in sich trägt. Das lässt vermuten, dass hier ein Kausalbegriff ins Spiel kommt, der nichts zu tun hat mit einer bis ins Unendliche verlaufende Kausalkette, sondern mit einer, die einen ersten Anfang hat, und zwar im handelnden Subjekt.
Kausalität kommt im Vorigen offenbar in unterschiedlicher Weise zum Tragen: einmal im Sinne unbeschränkter Naturkausalität, zum anderen im Sinne einer Kausalität, die einen ersten Anfang hat, und zwar in einem bestimmten Menschen. Die zweite verbinden wir mit der Überzeugung, dass ihr Anfang nicht hätte sein müssen. Das Verwirrende an der Sache ist: beide Kausalitäten beziehen sich auf ein und denselben Sachverhalt. Wie kommen wir hier weiter?
Wenn irgendwo irgendwann von Kausalität die Rede ist und darüber Aufklärung verlangt wird, ist Kant die richtige Adresse. Es gibt wohl kein Werk von ihm, in dem nicht an irgendeiner Stelle das Wort „Kausalität“ auftaucht. Kant wäre nicht Kant, wenn er die Kausalität nicht auch im Verhältnis zur Freiheit bedacht hätte. Er hat es ausgiebig bedacht, vor allem in seinen Spätschriften. Hier ist herausgearbeitet, dass es neben der Kausalität in der Natur noch eine weitere Art von Kausalität gibt, nämlich jene, die im Ich beginnt. Das Ich ist, was die von ihm ausgehenden Wirkketten angeht, autonom. Es ist im „positiven“ Sinne frei, d. h. frei hinsichtlich seiner Spontaneität.
Ohne eine dahinterstehende Ursache kann im Ich als solchem ein Handlungsablauf beginnen. Das setzt voraus, dass das Ich als völlig eigenständige Ursache, als Ursache aus sich selbst heraus angesehen wird. Anders lässt sich das Verhalten des Richters und der Kinder in den beschriebenen Beispielen nicht erklären.
Das Verhältnis der „positiven“ zur „negativen“ Freiheit
Während der Zugang zum Freiheitsbegriff im negativen Sinne über ein real erlebtes Leiden erfolgt, z. B. dem Leiden an Unterdrückung, gelangen wir zur Freiheit im positiven Sinne über einen Reflexionsakt, der uns unsere Eigenspontaneität offenbart.
Wie stehen nun „positive“ und „negative“ Freiheit zueinander? – Der Freiheitsbegriff im Sinne von Nichtbehindertsein („Freiheit von …“) beruht auf dem Freiheitsbegriff im Sinne von Spontanautonomie. Er hat keine andere Funktion als der Spontanautonomie freie Bahn zu verschaffen (s. o.). „Negative“ Freiheit schafft Raum für „positive“ Freiheit.
Ohne vorausgesetzte Spontanautonomie kann etwas, das uns andere Menschen antun und das uns behindert, schlechterdings nicht als widernatürlich oder leidvoll empfunden werden. Hätten wir kein Freiheitsempfinden im positiven Sinne, würden wir gegen uns gerichtete menschliche Akte gar nicht als Behinderung erleben. Wir würden sie als Naturereignisse deuten und im Rahmen der Naturkausalität verorten. Wir nähmen sie schlicht hin und stellten uns klaglos darauf ein. Wir würden so reagieren, wie wir auch sonst auf Naturereignisse reagieren.
Der Freiheitsbegriff im Sinne von „der Eigenspontaneität ihre Bahn!“ fällt ohne den Freiheitsbegriff im Sinne von „Autonomie der Eigenspontaneität“ in sich zusammen. Lässt man die als „negativ“ bezeichnete Freiheit (Freiheit von …) für sich allein bestehen, wie das Viele tun, hätte man gar keine Freiheit. Freiheit als ganze wäre verloren.
„Das Dogma der individuellen Freiheit ist kein Pfifferling mehr wert, sobald wir Nationalsozialisten die Macht im Staate übernehmen“. So soll sich Adolf Hitler schon vor seinem Machtantritt in aller Öffentlichkeit geäußert haben. Wohl kaum jemand konnte ihm etwas Substanzielles entgegensetzen, nicht zuletzt wegen der Dürftigkeit, mit der damals z. B. die Liberalen ihren Freiheitsbegriff (als bloß „negativen“!) ins Spiel brachten. Bis heute fechten sie nur für einen „negativen“ Freiheitsbegriff. Diese Schwäche wurde schon früh erkannt: Die radikale Kritik Max Stirners am gewöhnlichen Liberalismus ist legendär: Wenn es nur darum geht, frei von etwas zu sein, dann sind nämlich alle liberal. Stirners Zynismus könnte sich auch gegen aktuelle Theoriegebilde in Sachen „Freiheit“ richten. Man muss nur einmal den Begriffsapparat einiger „Freiheitsfreunde“ etwas genauer unter die Lupe nehmen.
Der negative Freiheitsbegriff (Nichtbehinderung der Spontaneität) ist innerhalb der Grenzen, die man ihm setzen muss, durchaus brauchbar. Er kann uns einen Hinweis darauf geben, welche Einschränkungen die „positive“ Freiheit erfahren muss, um ein schlüssig-human organisiertes Zusammenleben zu ermöglichen, und zwar für alle Menschen. Er sagt uns etwas über unzulässige Behinderungen. Aber nur in Bezug auf die Freiheit im positiven Sinne (Spontanautonomie) kann sinnvoll gefragt werden, ob und wie sie „mit jedes anderen Freiheit … zusammen bestehen kann“ (Kant). Darauf ist gesondert zurückzukommen.