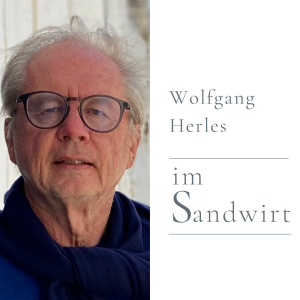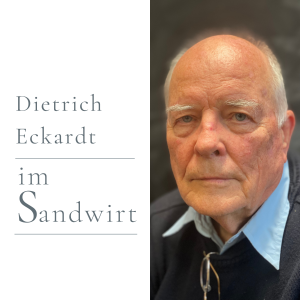Diesen Text gibt es auch als Episode im Wurlitzer, dem Podcast des Sandwirts: Hier.
Der menschliche Kosmos #2
In den vergangenen Jahrzehnten hat das Denken neue Bereiche eröffnet, es sind Begriffe wie „systemisch“, „vernetzt“, „ganzheitlich“ oder „komplex“ aufgekommen, ohne dass sie das Alltagsverhalten wirklich verändert hätten; oft sind sie nur Worthülsen, hinter denen sich tief eingewöhnte Denk- und Umgangsformen verbergen. Denn nach wie vor wird für fast jedes Problem nach einer „Ursache“ gesucht und für jeden Schaden nach einem Schuldigen – und ebenso oft geht es um die Macht: die informelle und materielle.
Wie ließe sich das Herangehen an komplexe Systeme verbessern? Ein paar Einsichten können helfen:
- Auf die „wirkliche Vergangenheit“ haben wir keinen Zugriff, denn es gibt keine Zeitmaschine, die ihn uns verschaffen könnte. „Vergangenheit“ – also jedes Ereignis in zurückliegender Zeit – lässt sich nur in Hervorbringungen unseres Gehirns „behandeln“, als Konstrukt, als Modell. Das Modell kann umfänglich sein und viele Details enthalten, wenn viele Gehirne an seinem Zustandekommen beteiligt sind – es bleibt ein Modell. Die vermeintlichen „Ursachen“ sind also ebenfalls Konstrukte. Das aber bedeutet, dass jede „Vergangenheit“ – jede Modellbildung überhaupt – unlösbar mit den Zielen desjenigen verbunden ist, der sie modelliert, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. Es gibt keine von Zielen menschlichen Lebens abgekoppelte „Objektivität“ – weder im Denken noch im Handeln.
- Nirgendwo in unserer Umgebung gibt es irgendein System – und das gilt vor allem für lebende Organismen –, das existieren könnte, ohne in Bewegung zu sein. Das gilt für die „innere“ Bewegung, mit der das System seine charakteristische Form aufrechterhält und für die „äußere“ Bewegung, in der das System mit seiner Umgebung wechselwirkt. Es ist diese Bewegung, die als „Zeit“ wahrgenommen wird.
- „Innere“ und „äußere“ Bewegungen sind verkoppelt und konkurrieren miteinander. Jedes einzelne System hat das Ziel, sich in Form und Funktion zu erhalten, das heißt, die für seine innere Bewegung nötige Energie zu erlangen und äußere Störungen zu vermeiden. Eine der wesentlichen Strategien ist, dass sich viele Individuen – oder einzelne Zellen – zusammenschließen zu Schwärmen – bzw. neuen Organismen. Deren Form und Funktion ist nicht mehr durch einfache Ursache-Wirkungs-Schemata von der einzelnen Zelle – vom Individuum – abzuleiten.
Anschauliche Beispiele sind Schwärme von Fischen und Vögeln oder Schleimpilze, Vielzeller, die sich schneckenhaft fortbewegen. Darin haben einzelne, zuvor amöbenartig lebende Zellen einer bestimmten Art von Schleimpilzen die selbständige Existenz aufgegeben, wurden ununterscheidbare Teile eines „Metasystems“ mit qualitativ völlig anderen Erhaltungsstrategien und Bewegungsmustern als die Teilorganismen.
Menschenmassen können „Schwarmqualität“ erreichen. Physisch ist das bisweilen in Zeitrafferaufnahmen sicht-, im Lärm der Sportstadien hörbar. Der Einzelne verschwindet darin. Die Kommunikationskanäle, deren es dazu bedarf, sind ein Hauptthema, dieses Buches.
- Es gibt kein perpetuum mobile also ein System, das – seine Energie selbst erzeugend, sich selbst erhaltend, völlig geschlossen und von Wechselwirkungen unabhängig existiert. Diese Wechselwirkungen lassen sich von Strategien des Erlangens- und Vermeidens aus – also anhand der Ziele der wechselwirkenden Systeme – statt von deren „Vergangenheit“, ihren „Ursachen“ aus betrachten.
Training für die Wahrnehmung
Erscheint Ihnen diese veränderte Art, Menschen und ihre Umwelt anzuschauen, irritierend, womöglich unlogisch? Kein Wunder, denn fast jeder ist mit Begriffen wie „Vergangenheit“ und „Ursache“ verwachsen – genauso selbstverständlich, wie sein Gehirn „kopfstehende“ Bilder von der Netzhaut umdreht. Es ist ein winziger Teil einer ungeheuren, andauernden, unzertrennlichen und komplexen Zusammenarbeit zwischen Körper, Gehirn – also Gedächtnis – und Welt.
Die Irritation beim Wechsel von der Frage “WARUM?” zur Frage „WOZU?“ ist von derselben Art, wie sie ein Rechtshänder empfindet, der wegen einer Verletzung lernen muss, mit der linken Hand zu schreiben.
Könnte man nicht ebenso gut trainieren, bei der Einschätzung des Umgangs mit Menschen und Umwelt eben nicht nur die – bewährte, aber begrenzte – Methode der Konstruktion von Ursachen und Vergangenheiten zu nutzen? Dann ließen sich womöglich Muster anders erkennen: Fragen Sie etwa „Was wollen die am Geschehenen Beteiligten erlangen, was vermeiden?“, wenn Sie auf den Verlauf innerer und äußerer Energieflüsse, die Bewegungen dynamischer Systeme und Metasysteme blicken, und versuchen Sie einmal, den Einfluss Ihrer eigenen Impulse zum Erlangen und Vermeiden mit zu erfassen und zu reflektieren.
Dieser Wechsel der Perspektive ist nicht neu. Wieso ihn nicht nur für den Bau von Lasern, Quantencomputern oder einzelne klinische Anwendungen der Psychologie vollziehen, sondern für Ihren Alltag nutzbar machen?
Nicht nur das naturwissenschaftliche Denken, sondern auch Psychologie und Philosophie profitieren davon. Seit einiger Zeit ist der Begriff der „Propriozeption“ im Gebrauch. Er bezeichnet die Eigenwahrnehmung des sich bewegenden Körpers, also die Wahrnehmung fortwährend und meist unbewusst ablaufender Impulse. Sie umfasst nicht nur motorische Bewegungen wie Laufen, Schwimmen, Springen, sondern auch die Lage unserer Organe im Raum und die Motorik der nonverbalen Kommunikation – also etwa das Lächeln, Hochziehen der Brauen, Redegesten, den Tränenfluss, Schreien und Lachen. Darauf werde ich im Teil 4 ausgiebig zurückkommen.
Im Fokus: Impulse
Impulse haben stets ein Ziel. Folgerichtig wäre, den Blick auf sie zu fokussieren für einen wesentlichen Komplex menschlicher Existenz: Impulsverläufe in Konflikten.
Damit bin ich wieder beim Phänomen der Gewalt. Das Ziel von Gewalt ist Destruktion. Sie erstrebt einen chaotischen – regellosen – Zustand, von dem aus eigene Interessen durchgesetzt, fremde Interessen ausgeschaltet oder stark abgeschwächt werden können. Sie nimmt schwere Störungen, ja sogar die Vernichtung des eigenen Systems in Kauf. Es ist riskantes Verhalten mit einem seltsamen inneren Wechselspiel zwischen Angst und Lust.
Gewalt ist nur eine von vielen elementaren Strategien gegen innere oder äußere Störungen des dynamischen inneren bzw. äußeren Gleichgewichts. Auf menschliche Konflikte bezogen: ein Ziel wird erreicht oder ein Schaden vermieden durch destruktives Verhalten; das Risiko, dabei schwerere Verluste zu erleiden, gar zu sterben, wird ignoriert. Das kann spontan geschehen oder bewusst, und es wird umso wahrscheinlicher geschehen, je öfter sich eine gewaltsame Strategie mit erlebtem Erfolg verbindet – egal ob es sich um einen vermeintlichen oder wirklichen Erfolg handelt.
Was Sieg, was Niederlage ist – darüber entscheidet die subjektive Wahrnehmung. Strategiewechsel infolge von Niederlagen sind selten. Ich wage zu behaupten: sie sind niemals durchgreifend. Nachzuweisen, dass jemals irgendeine Strategie zwischen den Anfängen der Evolution und dem „Anthropozän“, zwischen Steinzeit und „Postmoderne“ ausgestorben wäre, bedürfte einer aufwendigen, höchst wahrscheinlich erfolglosen Suche. Sicher ist nur eines: Im „Ernst-“Fall, wenn der “Tunnelblick” die Selbstwahrnehmung einschränkt, werden alle anderen möglichen Strategien ausgeblendet bis zum Amoklauf: der „Totale Krieg“ zerstört andere und sich selbst.
Wer den Schaden hat…
“Aufarbeitung” ist ein ebenso häufig wie fahrlässig gebrauchtes, bis zum Überdruss verschlissenes Wort. Sie folgt Katastrophen so sicher wie das Amen in der Kirche: Sie ist auch meist nichts als Ritual. Jeder, der seine Haltung, Ziele, Handlungsmotive vorteilhaft darstellen will, distanziert sich rituell von den an Katastrophen “Schuldigen”. Die Deutungshoheit über die Frage “Warum” wird zur Monstranz – unangreifbar – die eigene Position ist geheiligt.
So geschah es mit der “antifaschistischen Aufarbeitung” des Nationalsozialismus durch marxistisch-leninistische Staatsideologie. „Antifaschismus“ wurde gegen den Aufstand der Arbeiter in der DDR am 17. Juni 1953 – man nannte ihn „faschistische Konterrevolution“ – ebenso ins Feld geführt wie für den Ausbau der tödlichen Grenzsicherung gegen Flüchtlinge, den „Antifaschistischen Schutzwall“. Das Abzeichen „Antifa“ heften sich heute gern Extremisten ans Revers und leiten daraus ihr Recht auf Anschläge, Plünderungen, Drohungen und physische Gewalt gegen jeden ab, der sich ihrer Deutungshoheit nicht unterwirft.
Eine Ironie der Geschichte ist, wenn deutsche „Antifaschisten“ den offen demonstrierten Vernichtungswillen von Terrorarmeen wie der Hamas und Hisbollah und der sie bewaffnenden Staaten zum Ausrotten Israels verharmlosen, gar gutheißen, während deutsche Politiker die Sicherheit Israels zur „Staatsräson“ erklären.
Kann man aus der Geschichte lernen? Tatsächlich verirrt sich die Frage nach dem „Warum“ zwischen Ratlosigkeit, unbrauchbaren Spekulationen, Schuldzuweisungen im Nebel der Unverantwortlichkeit, wenn es um Gewaltherrschaft zum Beispiel von Nationalsozialisten, Islamisten, oder Kommunisten, um Massaker an unterworfenen Völkern, Amokläufe in Schulen oder Familien, um Terrorakte und katastrophale Schlampereien in Kernkraftwerken oder Chemiefabriken geht.
Das ist kein Zufall. „Ursachen“ sind Konstrukte, Resultate menschlicher Denk- und Kommunikationsprozesse. Wie wäre es, vorab nach den Zielen derjenigen zu fragen, die da „aufarbeiten”? Es ist erlaubt, sie an diesen Zielen zu messen. Danach kann über die Ziele derjenigen reflektiert werden, die „in der Vergangenheit” handelten, darüber wie sie das Für und Wider ihres Handelns wahrnahmen, wie sie zu Entscheidungen kamen.
Sinnvoll vergleichen
Diese Vorgehensweise offenbart eine Dynamik sich häufig wiederholender Muster. Wer rechtzeitig und vorbehaltlos nach den eigenen, dann nach den Zielen anderer fragt und beides in ein Verhältnis bringt, wer das fragt, solange Schlamperei, Feindseligkeit, Gewalt noch „latent“ sind, kann dank erkannter Muster künftige Konfliktverläufe abschätzen, womöglich sogar manche Katastrophe abwenden. Auf unabwendbare wird er sich einrichten müssen. Konflikte sind letztlich so wenig vorhersehbar wie Individuen einheitlichen Handlungsmustern folgen, so wenig sich „Tugenden” und „Laster” säuberlich scheiden lassen.
Hierzu sei beispielsweise auf Nietzsches interessante aphoristische Gedanken in „Menschliches, Allzumenschliches“ und auf Elias Canettis “Masse und Macht” verwiesen. Beide bereichern die Diskussion um den „Freien Willen“ in hohem Maß.
Sind die Ketten der Kausalität, des Denkens in Abfolgen von Ursachen und Wirkungen, gesprengt, können die Konflikte des Individuums und der Metasysteme von Familien, Nationen, Völkern und ihren Kulturen besser verstanden werden. Quantenphysik, Relativitätstheorie und Informatik haben längst offenbart, wie brüchig diese Ketten sind. Wer sich nicht befreit, wird die Krisen und Katastrophen der sich global organisierenden Menschheit nicht verstehen, geschweige verhindern.
„Wer die Ursachen beherrscht und die Deutungshoheit über sie erreicht, gebietet über die Folgen” – auf dieser Einstellung fußen Strategien der mechanischen Dominanz. Wir erleben aber am Beispiel des weltweiten Terrorismus gerade, dass auch das gewaltigste Übergewicht mechanischer (militärischer) Instrumentarien systemische Prozesse nicht steuern kann.
Ideologien verstellen den Blick
Der Perspektivenwechsel wird sich durchsetzen, weil er keiner ideologischen Rechtfertigung bedarf. Genau deshalb ist allerdings das Zeitalter universeller Gesellschaftsentwürfe vorbei. Sie waren immer die gedanklichen Rechtfertigungen für mechanische Dominanz, ihr systematischer Fehler ist, dass sie eine „Objektivität“ oder göttliche Herkunft von Modellvorstellungen, von „Vergangenheit“ und „Gegenwart“ erforderten, mit der „Zukunft“ zu prognostizieren ist – bis hin zur sogenannten „Weltformel“ oder zum „Weltgericht“. Aber eine solche Formel kann und wird es niemals geben.
Die Revolution unserer Zeit ist der revolutionierte Zeitbegriff: Der Mensch erschafft Raum und Zeit unseres Universums mit, während er denkt, Denken ist schon Handeln, und die Dynamik dieser unauflösbaren Wechselwirkung kann nicht formelhaft „fixiert“ werden, weil eine Fixierung das Ende der Dynamik selbst bedeuten würde. Die neue Perspektive widerlegt indessen keineswegs den Sinn der Forschung, sie zeigt nur deutlicher die eigenen Grenzen; mechanische Vorstellungen versagen darin.
Reden wir vom Ziel dieses Buches: Es will keine neuen Weisheiten verkünden, sondern ein Training anbieten: Leser können versuchen, öfter statt nach dem „Warum“ nach Zielen und Strategien zu fragen, sie können versuchen, ihren eigenen Alltag anders zu erleben und zu gestalten – egal ob sie es in der internationalen Politik, im Management oder in den eigenen vier Wänden tun. In diesem Sinne ist es ganz und gar unvollkommen, weil es darauf vertraut, dass es nur Anregungen für alle diejenigen gibt, die – mit neuer Sicht auf die Welt und sich selbst – handelnd Erfahrungen machen und neue, wichtigere Kapitel schreiben werden. Es lebt von der Subjektivität der Wahrnehmung, und gibt die Subjektivität des Autors immer wieder preis. Es soll Lust darauf machen, einige der vielen alltäglichen „Algorithmen“, Rituale und Strategien kennenzulernen, mit denen unser Gehirn, unser Körper und die umgebende Welt – der „menschliche Kosmos“ – aufeinander wirken. Das wenigste davon ist dem Menschen bewusst, eben weil sein Bewusstsein um Größenordnungen von der Dimension des Kosmos entfernt ist. Aber Entdeckungsreisen sind möglich. Im Himmel und auf Erden.
Kommen Sie mit, wir fangen ziemlich weit unten an.
Liz Taylor an der Köttelbecke
Beginnen wir die Entdeckungsreise in den 90er Jahren. Damals wohnte ich mit meiner Frau zur Miete in einem Haus mit Garten an der „Köttelbecke“. Kennen Sie nicht? So hießen die offenen Abwasserkanäle des Emschersystems im Ruhrgebiet. Die kleinen Gärten hinterm Reihenhaus waren in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts noch typisch . Ebenso die Betonrinnen für Abwässer quer durch die Siedlung; sie konnten wegen der vom Bergbau verursachten Erdbewegungen nicht unterirdisch verlegt werden und rochen im Sommer oft übel. Bei schönem Wetter saß ich trotzdem gern auf der Wiese und rauchte Pfeife.
Unsere Nachbarn am anderen Ufer, ein Ehepaar von etwa sechzig Jahren, waren fast immer in ihrem Gärtchen. Sie hatten sich sogar einen kleinen runden Pavillon mit grünen Fensterscheiben gebaut, obwohl es vom Liegestuhl nur ein paar Schritte ins Haus waren. Wir wunderten uns anfangs, wieso jemand sich in einem Gartenhaus grüne Gardinen vor die Fenster hängt, bis wir bemerkten, dass es weiße Stores hinter grünen Scheiben waren, die uns befremdeten, vermutlich ein Sonderangebot.
Ebenso befremdlich erschien uns, dass im Pavillon, den aufzubauen einiges Geld und gute zwei Wochenenden handwerklicher Arbeit gekostet hatte, offensichtlich nur Gartenmöbel untergestellt wurden. Auch dieses Rätsel löste sich: der Pavillon beherbergte etwas viel Kostbareres. Dort stand – in Reichweite, nicht etwa in der eine Gehminute entfernten Küche – der Kühlschrank, und im Kühlschrank war das Bier.
Für unsere Nachbarn war wichtig, das Bier in der Nähe zu haben, weil sie sich fast immer stritten. Sie redeten ausdauernd aufeinander ein, und die wellenförmig aufbrandenden Gespräche gipfelten in Beleidigungen.
Ein solcher Zyklus der Aufregung lief aber nicht synchron mit dem Leeren einer Bierflasche ab. Wir konnten zunächst nicht herausfinden, wer von beiden mehr und schneller trank, aber einerlei: es wäre anscheinend einem Koitus Interruptus gleichgekommen, hätten sie eine besonders heftige Attacke wegen einer leeren Flasche, eines dann also erforderlichen Ganges in die Küche, unterbrechen müssen. Tatsächlich war der Kühlschrank im Pavillon mit den grünen Fensterscheiben Teil eines ebenso detailliert wie unbewusst inszenierten und mit nicht nachlassender Energie aufgeführten Dramas.
Die beiden quälten einander mit Hingabe, sie genossen im Gleichmaß Bier und Beschimpfungen, sie büßten an Schwung und Emotionalität nie ein. Es wäre sinnlos, Gründe für das Gezänk finden zu wollen, nicht einmal Anlässe ließen sich erkennen – außer dass die Sonne schien und Bier im Kühlschrank war.
Soweit wir den zu uns über den Zaun herüber wehenden Sprachfetzen vertrauen konnten, währte die Beziehung trotz der Konflikte an der Grenze zur Gewalttätigkeit schon dreißig Jahre.
Wir begannen zu verstehen, dass Mann und Frau nicht um Gründe von Ärgernissen stritten, die auszuräumen waren. Sie stritten schon gar nicht um geänderte Formen des Umgangs miteinander. Bei all der wiederkehrenden Aufregung, all dem Reden und Gestikulieren, während sie sich gegenseitig aufreizten und ankeiften, ging es im Gegenteil darum, dass sich nichts verändern sollte, sondern dass jeder immer wieder aufs Neue seine Rolle, seine Wahrnehmung von sich selbst gegen den anderen verteidigte.
Es handelte sich um eine Dynamik, deren Ziel das Gleichgewicht war. Und genau deshalb, um dieser zum Ritual gewordenen Dynamik willen, unterschieden sich die Konflikte unserer Nachbarn nicht von vielen Konflikten zwischen Parteien, Völkerstämmen, Nationen, religiösen Gemeinschaften. Dort allerdings kann ein Gewaltausbruch Schlimmeres bewirken als ein blaues Auge und ein paar zerschlagene Bierflaschen.
Die Widerstandskraft der Banane gegen die Frage „Warum“
Dieses Buch will sich – wie im Vorwort angekündigt – mit der Dynamik menschlicher Wechselwirkungen befassen und dabei die vertraute Perspektive des Denkens verlassen. Fast alle sind gewohnt, das Handeln der Menschen auf seine Gründe hin zu untersuchen. Aber diese Suche führt nur zu ebenso begrenzten Einsichten, wie die Vorstellung, dass die Sonne im Osten auf- und im Westen untergeht.
Wer nach Gründen fragt, entwirft eindimensionale Modelle von zurückliegenden Ereignissen. Im Falle unseres Ehepaares hieße das etwa, dass die Frau ihren Mann einen Schlappschwanz nannte, weil er seinen ehelichen Aufgaben unzureichend nachgekommen war. Natürlich könnte jeder daraufhin den Mann als den am Konflikt Schuldigen ausmachen. Als unbeteiligter (und von den Streitenden nicht bemerkter) Beobachter könnte er sich mit dieser Einsicht zufrieden geben und sein Urteil über die Verhaltensmuster der nachbarlichen Ehe fällen.
Dadurch wird er mit großer Wahrscheinlichkeit völlig falsch urteilen. Wie falsch, wird ihm spätestens klar, wenn er von dem Ursache-Wirkungs-Schema auf andere eheliche Konflikte schließ t, womöglich auf seine eigenen. Er ist nämlich nie „objektiv“ urteilender Beobachter, schon deshalb, weil der Streit im Garten statt in der Wohnung geführt wird und die Streitenden sehr wohl mit Zuhörern rechnen.
Der Beobachter ist als unsichtbarer Richter an den Wechselwirkungen beteiligt, wird von den Streithähnen mit allen möglichen Gefühlen und Trieben bombardiert, als wollte jeder der beiden ihn auf seine Seite ziehen. Der Zuschauer soll nicht ihre Behauptungen prüfen, er soll Partei werden. Der „Schlappschwanz“ hat mit der erotischen Leistungsfähigkeit des Mannes weniger zu tun, als mit der Absicht der Frau, ihn öffentlich zu demütigen. Als Beobachter sind Sie nicht „unbeteiligt“, Sie sind sich nur des emotionalen Widerhalls der Streitereien kaum bewusst.
Der Streithahn reagierte auf den „Schlappschwanz“ stets mit routinierter Abwehr, und seine Reaktion fiel für die Frau so wenig überraschend aus, wie er selbst von den Versuchen überrascht wurde, ihn zu demütigen. Das Drama an der Köttelbecke führte nicht zur Auflösung der Ehe, es erhielt sie am Leben.
Theater ist immer und überall
Edward Albee hat Ähnliches in sein brillantes Theaterstück „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“ hineingeschrieben; der Film mit Elizabeth Taylor und Richard Burton wurde vermutlich schon deshalb zum Klassiker, weil die beiden Schauspieler sehr nahe an eigenem Erleben agierten. Dramen wie die von Albee lassen beispielhaft nachempfinden, dass Sozialgebilde – nichts anderes ist eine Ehe – den gleichen Strategien folgen, wie andere lebendige Formen: Sie bilden in sich relativ geschlossene, dennoch für den Energie- und Stoffaustausch mit der Umwelt offene, dynamische Systeme mit dem Ziel der Selbsterhaltung und Reproduktion.
Nicht nur – aber am einfachsten – durch Ausbrüche von Gewalt und Zerstörung werden aus Zuschauern Mitfühlende von Dramen. Sie absolvieren meist unbemerkt ein „Mitspielen“ ihrer eigenen Gefühle und Konfliktstrategien. So verwickeln Bühne, Film, manchmal sogar das Fernsehen ihr Publikum in die Dynamik von Sozialgebilden, etwa einer Ehe an einer amerikanischen Kleinstadtuniversität oder an einer Köttelbecke in Wattenscheid. Eine Zeitlang waren nachmittägliche TV-„Pöbelshows“ echte Serienerfolge; die Teilnehmer – Ehepaare, Ex-Partner, Nachbarn – machten sich gegenseitig bis zum Exhibitionismus coram publico zur Sau.
In politischen Talkshows und ihren Scharmützeln aus Worthülsen lebt die voyeuristische Unterhaltung fort; womöglich gehen „social media“ und Strategiespiele im Cyberspace noch eine Stufe weiter. Eine gewaltige Medienindustrie bewirtschaftet – und manipuliert – so die Gefühle von Milliarden.
Macht es Ihnen etwas aus, wenn Sie Ihren Konsum an mehr oder weniger digital erzeugten Emotionen daraufhin etwas genauer prüfen? Oder lässt Sie all das völlig kalt?
Wie stark emotionale Signale wirken, haben Hirnforscher in jüngster Zeit anhand der Aktivität der sogenannten „Spiegelneuronen“ nachgewiesen. Bewusste Handlungen und Erkenntnisse spielen in den ununterbrochen ablaufenden sozialen und psychischen Vorgängen nur eine Nebenrolle. Die Strategien, deren sich Partner in einer Ehe bedienen, folgen konkurrierenden Interessen beider. Im ununterbrochenen Wechsel von Impulsen des Erlangens und Vermeidens – und der läuft weitgehend unbemerkt ab – wechseln auch die Gefühle und müssen immer wieder ausbalanciert werden.
Äußere Gefährdungen können eine Bindung festigen – ebenso gut aber eine geschwächte Bindung zerbrechen. Nur eines ist sicher: weder innere noch äußere Konflikte lassen sich dauerhaft ausschließen. Normalerweise werden sie nicht mit der Keule oder dem Maschinengewehr ausgetragen, auch wenn Angst und Aggressivität nicht selten destruktive Phantasien anheizen. Dennoch haben Menschen die Gewalt als letzten Ausweg „im Programm“, und sie ist mit ausgesprochenen Lustgefühlen verbunden. Gerade Kinder geben durchaus lustvoll sadistischen Strebungen nach. Wenn ihre Erfahrung vor allem von Ohnmachts- und Gewalterlebnissen geprägt wird, werden sie entsprechend wenig andere Strategien einsetzen können, um ihre Ziele zu erlangen oder Nachteile zu vermeiden.
All diese Vorgänge lassen sich nicht in Ursache-Wirkungs-Schemata auflösen, darauf werde ich immer wieder zurückkommen müssen. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie mir gelegentlich –etwa per Kommentar – mitteilten, was Sie erlebt und beobachtet haben.
Um mehr zu erfahren als die Bestätigung von Vorurteilen, werde ich mich einer anderen als der mechanisch-kausalen Methode bedienen. Sie hat die Naturwissenschaften – vor allem die Physik – im zwanzigsten Jahrhundert revolutioniert und so erfreuliche Erfindungen wie den Laser und den Kernspintomographen beschert. Man muss nicht allzu viel von Physik verstehen, um den Nutzen der Methode zu begreifen. Es gehört dazu nur eines: die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und den Standort des „objektiven Betrachters“ zu verlassen, die Fähigkeit, sich in unterschiedliche Absichten und Ängste der an einer Wechselwirkung Beteiligten „einzufühlen“.
Nur Mut! Versuchen Sie mitzufühlen, wie Sie auf andere wirken, öffnen Sie Augen und Ohren für nonverbale Signale !
Diese Fähigkeit haben fast alle, und dieses Buch soll sie ermuntern. Es wird sich mit Rollen und Ritualen befassen, mit Gefühlen und Konflikten, die unsere Wechselwirkungen mit anderen Menschen und auch mit uns selbst bestimmen – bis hin zu Gewalttaten. Spüren wir – Sie, geneigter Leser und ich – also der Dynamik des menschlichen Kosmos nach, einschließlich der Katastrophen und chaotischen Verhältnisse, die mit Gewaltausbrüchen einhergehen, und die mit dem mythischen Dreigestirn GEWALT MACHT LUST zusammenhängen.
Diesen Beitrag im Wurlitzer anhören:
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.
Alternativ können Sie den Podcast auch bei anderen Anbietern wie Apple oder Overcast hören.